„Die OSZE – Struktur einer langfristigen Friedenspolitik.“ Ein Gespräch mit Dr. Wilhelm Höynck, dem ersten Generalsekretär der OSZE
Die 1993 gegründete „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (OSZE) blickt auf eine lange Vorgeschichte zurück; wichtige Eckdaten waren u. a. die Jahre 1975 (Helsinki) und 1990 (Paris). Können Sie ganz kurz die Grundlinien dieser Entwicklung skizzieren?
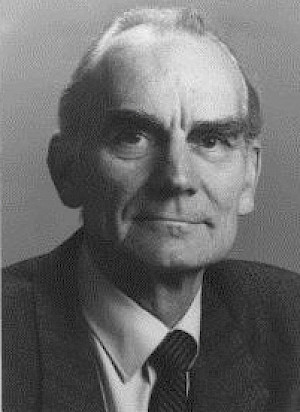
Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben sich in einem kontinuierlichen Prozess entwickelt, und zwar in drei sehr unterschiedlichen Phasen.
Am Anfang stand, zu Beginn der sechziger Jahre, ein Vorschlag der Sowjetunion für eine Europäische Sicherheitskonferenz; und zwar mit dem Ziel, die Teilung Europas festzuschreiben. Es folgte ein langer Ost-West-Diskurs über mögliche Inhalte und Formen einer solchen Konferenz. Schließlich trafen sich 1975 am Ende zweijähriger vorbereitender Verhandlungen die 35 Staats- oder Regierungschefs der europäischen Staaten, der USA und Kanadas in Helsinki. Die von ihnen unterzeichnete „Helsinki-Schlussakte“ war kein völkerrechtlicher Vertrag; aber sie formulierte als Grundlage weiterführender Entspannungspolitik eine Reihe von Prinzipien und konkreter politischer Verpflichtungen.
Die zweite Phase, bis Ende der achtziger Jahre, war gekennzeichnet durch drei KSZE-Folgekonferenzen. Sie trugen dazu bei, die beginnende Entspannung zwischen Ost und West auch für die Menschen spürbar zu machen und den KSZE-Prozess trotz schwerer Rückschläge weiter voranzutreiben.
Am Beginn der dritten Phase stehen der Fall der Berliner Mauer und die sich anbahnende Zeitenwende. Im Herbst 1990 beurkundet dann die „Charta von Paris“ das Ende des Ost-West-Konflikts; sie spricht auch von der Vision eines neuen Zeitalters der Demokratie, des Friedens und der Einheit für Europa. Mit der Charta beginnt der Umbau der KSZE: Von einer Serie diplomatischer Konferenzen zu einer selbst handlungsfähigen internationalen Organisation.
Gab es in den Anfängen des KSZE-Prozesses inhaltliche Schwerpunkte, die für die weitere Entwicklung von besonderer Bedeutung waren?
Aus meiner Sicht war entscheidend, dass die Ost-West-Agenda im Vorlauf zu Helsinki verändert wurde. Sie war in den kritischen Phasen des Kalten Krieges beherrscht worden von dem Thema militärischer Sicherheit. Im Verlauf der Diskussion über eine Sicherheitskonferenz entwickelte der Westen ein neues, umfassenderes Verständnis von Sicherheit. Es reiche nicht, dass Staaten – sprich NATO und Warschauer Pakt – sich militärisch sicher fühlen. In einem friedlichen Europa müssten sich auch Bürger und Bürgerinnen sicher und frei fühlen. Deshalb müsse man in einer Sicherheitskonferenz auch über Menschenrechte sprechen. „Freer movement“, wie damals die westliche Parole hieß, größere Bewegungsfreiheit für Menschen, Ideen und Güter komme auch dem Interesse des Ostens an mehr wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Ost-West-Austausch entgegen. So entstanden für Helsinki unter der Überschrift „Sicherheit“ drei Themen-Körbe: Einer für Grundsatzfragen und militärische Sicherheit, einer für Wirtschaft und Umwelt, einer für zunächst so genannte Humanitäre Fragen. Mit dieser Erweiterung der Agenda, in der Rückschau ein Paradigmenwechsel hin zu umfassender Sicherheitspolitik, entstand auch die notwendige Masse für west-östliche Kompromisse. So öffneten sich ab 1975 im Eisernen Vorhang kleine Fenster und Türen; und es ergaben sich Ansätze für rudimentäre zivile Rechte der Menschen überall im KSZE-Raum.
Entscheidend für die weitere Entwicklung in Europa war auch, dass in der Schlussakte zwei Grundsatzfragen geklärt wurden. Mit großem Einsatz, insbesondere der deutschen Bundesregierung und der USA, gelang es, das Prinzip des Gewaltverzichts und das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen zu qualifizieren, und zwar durch einen ausdrücklichen Hinweis auf die Zulässigkeit von „peaceful change“, von friedlichem Wandel. Der europäische Status quo wurde nicht absolut unveränderbar, sondern die Geschichte blieb offen, auch für eine deutsche Wiedervereinigung.
Niemand hat allerdings in Helsinki geplant oder auch nur geahnt, was 15 Jahre später Wirklichkeit wurde: das Ende der DDR, der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Europa und eine Flut von Sezessionskonflikten und Sezessionskriegen. Angesichts dieser völlig überraschenden Veränderungen fand im September 1990 das Gipfeltreffen der KSZE in Paris statt. Alle spürten, dass es dabei um die Zukunft Europas ging. Orientierungspunkt der Charta von Paris wurde der sich abzeichnende neue und breite Konsens zu Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie zu sozialen, am Markt orientierten Wirtschaftsordnungen.
Beim Gipfeltreffen in Paris kam es unter dem Eindruck der sich vollziehenden Zeitenwende auch zu einer Einigung auf erste operative KSZE-Strukturen. Während der nächsten zwei Jahre wurde der Ausbau zu einer handlungsfähigen KSZE abgeschlossen und der Name in Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geändert. Allerdings scheiterte die Gründung einer rechtlich vollwertigen internationalen Organisation vor allem am Widerstand der USA, die negative Rückwirkungen auf die NATO fürchteten.
Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war ein wichtiger Impuls für die Entspannungspolitik der sechziger und siebziger Jahre, gab zugleich aber – was im „Ostblock“ sicher nicht beabsichtigt war – den Dissidentenbewegungen starken Auftrieb („Charta 77“ usw.). Wie schätzen Sie die Bedeutung des KSZE-Prozesses in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren ein?
Die KSZE hat vor allem dazu beigetragen, dass Menschen in Mittel- und Osteuropa sich aus ihren ideologischen und politischen Fesseln lösen konnten. Von der Staatenkonferenz in Helsinki sprangen unerwartet schnell Funken über auf Bürger und Bürgerinnen oder – wie wir heute sagen – auf die Zivilgesellschaft. Das begann bereits 1976, und zwar in Moskau. Eine Gruppe von Dissidenten verlangte von der sowjetischen Regierung die Gewährung der in der Schlussakte vereinbarten Freiheitsrechte. Nach kurzer Schockstarre der Sicherheitsorgane wurde diese Gruppe zwar zunächst ausgeschaltet; aber das Beispiel der russischen Dissidenten ermutigte Bürgerrechtler in anderen Staaten des Ostblocks, insbesondere in Polen und der Tschechoslowakei. Diese mutigen Leute nannten sich ausdrücklich Helsinki-Gruppen. Ihre Berufungsgrundlage war die Schlussakte, zu deren vollinhaltlicher Veröffentlichung sich alle KSZE-Staaten ausdrücklich verpflichtet hatten. Mitglieder der Helsinki-Gruppen nahmen nun die Schlussakte buchstäblich in die Hand und hielten sie den Behörden entgegen. Mit Recht hat deshalb 1990 die Charta von Paris hervorgehoben, dass sich Europa „durch den Mut von Männern und Frauen“ vom Erbe der Vergangenheit befreit hat.
Sie selbst haben dann als erster OSZE-Generalsekretär den Übergang von der KSZE zur OSZE ab 1993 mitgeprägt. Unmittelbar nach der gesellschaftlich-politischen Wende zeigte sich, dass aus ungelösten Problemen der Vergangenheit neue Konflikte entstanden, etwa im ehemaligen Jugoslawien und im Kaukasus. Wo lagen damals die entscheidenden Aufgaben, inwieweit konnten sie in Angriff genommen und gelöst werden?
KSZE und OSZE standen nach dem unerwartet schnellen Ende des Kalten Krieges vor völlig neuen Herausforderungen. Zunächst ging es vor allem um neuartige und heiße Klein-Kriege im Süden des KSZE-Gebiets, dann aber auch um Unterstützung für die schwierigen Transformationsprozesse der vormals sozialistischen Staaten. Die OSZE war drauf ebenso wenig vorbereitet wie alle anderen. Sie brauchte Instrumente, um schnell und konkret helfen zu können. Es begann mit der Entsendung von Feldmissionen, die Konflikte durch permanente Präsenz vor Ort beobachten und entschärfen konnten. Hinzu kamen Einrichtungen zur Verbesserung menschlicher Sicherheit, wie man heute sagen würde; spezifisch ging es um nationale Minderheiten und Pressefreiheit. Die Zusammenarbeit mit der UNO und anderen internationalen Organisationen wurde ein großes Thema; vor allem im Hinblick auf die Europäische Union (EU), die etwa zur gleichen Zeit mit dem operativen Ausbau der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik begann. Der Europarat hatte in Westeuropa große Erfahrungen auf Feldern, auf denen nun auch die OSZE in Mittel- und Osteuropa tätig wurde. Im Hintergrund der Entfaltung der OSZE stand von Anfang an die auch heute noch offene Frage nach der inklusiven und kooperativen euro-atlantischen/euro-asiatischen Sicherheitsarchitektur, die von allen – jetzt 57 – Teilnehmerstaaten der OSZE mitgetragen wird.
Gegenwärtig wird die OSZE leider kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen, obwohl sie z. B. mit dem „Hohen Kommissar für Nationale Minderheiten“ und dem „Beauftragten für den Bereich der Medien“ wichtige Aufgabenbereiche abdeckt. Welche Zukunft hat die OSZE Ihrer Ansicht nach in den nächsten Jahren?
Haben nicht alle Internationalen Organisationen ein Wahrnehmungsproblem? Auch die OSZE findet Aufmerksamkeit, wenn sie besonders gefordert wird: So war es in den neunziger Jahren und so ist es heute von Fall zu Fall; zum Beispiel bei Beobachtung heikler Wahlen. Tatsächlich kümmert sich die OSZE jedoch unverändert Tag für Tag und rund um die Uhr um „eingefrorene“ und neu aufflammende Konflikte, um eine Wiederbelebung der konventionellen Rüstungskontrolle und um Unterstützung von Staaten und Zivilgesellschaften auf ihren oft mühsamen Wegen zu Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Demokratie. Die OSZE wird aber angesichts wichtiger Entscheidungen immer wieder gelähmt von einem wachsenden Vertrauensdefizit zwischen Ländern östlich und westlich von Wien – wie man am Sitz der Organisation in der österreichischen Hauptstadt sagt. Russisches Ringen um Einflusszonen stößt zusammen mit der Nachbarschaftspolitik der EU, um nur einen aktuellen Grund zu nennen. Zunehmendes Misstrauen zwischen Ost und West geht natürlich nicht nur die OSZE an, aber es zeigt sich besonders negativ in der OSZE, weil diese Organisation Entscheidungen prinzipiell im Konsens trifft. Trotzdem bewährt sich die OSZE als Struktur einer langfristig angelegten Friedenspolitik gerade dann, wenn es zwischen den entscheidenden Mächten in West und Ost kriselt, denn sie ist Forum fortlaufender politischer Konsultation und Ort routinemäßiger Zusammenarbeit zwischen allen ihren Mitgliedern in Ost und West. Deshalb bleibt die OSZE auch in Zukunft eine der Koordinaten für ein freiheitliches Europa ohne Trennungslinien. In vielen Krisen bewährt, kann sie in besonderem Maße dazu beitragen, Europa vor einem Rückfall in traditionelle Machtrivalitäten zu bewahren.


